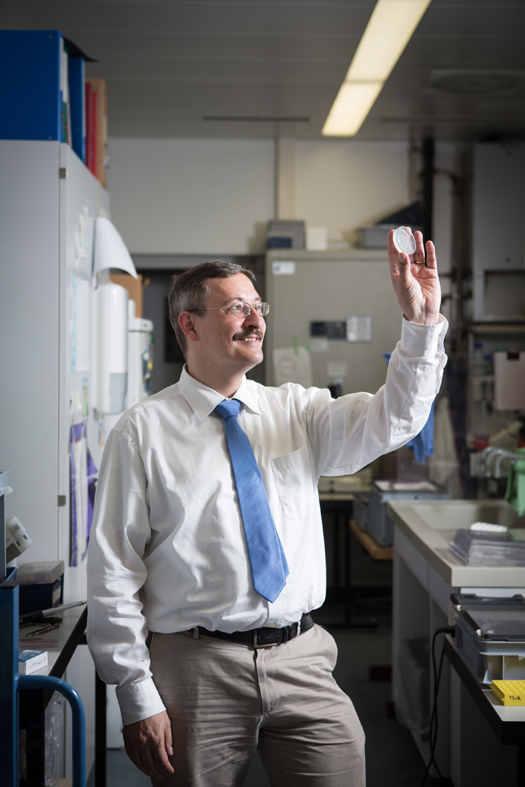Michael Hengartner über Sponsoringverträge, Studiengebühren und seine Ziele als künftiger Rektor der Uni Zürich
Wurmforscher Hengartner mit Petrischale: «Der Numerus clausus ist ein Rohrkrepierer.» Foto: Sabina Bobst
Interview: Nik Walter
Ab Sommer 2014 wird der Entwicklungsbiologe Michael Hengartner als Rektor die Geschicke der Uni Zürich, der grössten Uni der Schweiz leiten. Der kanadisch-schweizerische Doppelbürger kann genauso gut anpacken wie zuhören. Vielleicht deshalb gab es im Vorfeld der Wahl kaum Kritik an seiner Person.
Bei der Wahl unterstützten Sie die Studierenden genauso wie die Professoren und die Forschenden. Wie schaffen Sie es, bei allen so gut dazustehen?
Es wäre gefährlich, zu denken, man könne es immer allen recht machen. Das ist unmöglich. Möglicherweise habe ich die Leute überzeugt, weil ich mich voll für die Uni einsetze, ihnen zuhöre und sie ins Boot hole und weil ich mir Mühe gebe, immer zu erklären, warum man etwas macht.
Welche Prioritäten möchten Sie in dem neuen Amt setzen?
Drei Stichworte sind mir wichtig: Personen, Raum und Diversität. Personen, weil die Uni mit den Menschen, die hier arbeiten, steht und fällt. Es ist mir sehr wichtig, dass wir die besten Rahmenbedingungen offerieren und so auch die besten Köpfe aus der ganzen Welt rekrutieren können. Dann brauchen wir unbedingt mehr Raum, und zwar im wörtlichen und übertragenen Sinn. Die Uni ist massiv gewachsen in den letzten zehn Jahren, wir brauchen mehr Fläche für die Studierenden und die Forschung. Zudem müssen wir die Vielfalt der Uni bewahren.
Man hört, Sie seien einer, der gerne sagt, wo es langgehe. Mögen Sie Macht?
Macht ist das falsche Wort. Was ich mag, ist Neues aufzubauen.
Als Leader?
Ich muss nicht unbedingt Chef sein, ich kann auch sehr gut in einem Team arbeiten. Ich fühle mich wohl, wenn man Neues ausprobiert. Status quo ist nicht meine Stärke.
Wo sehen Sie an der Uni Zürich die grössten Baustellen?
Ich habe jetzt ein Jahr Zeit, mich in die Dossiers einzuarbeiten. Ein Thema ist sicher die Zusammenarbeit mit den Unispitälern. Die Spitzenmedizin ist ein gesellschaftlich wichtiges Thema, in das sich auch der Rektor einbringen muss. Wir müssen mit der Bildungs- und der Gesundheitsdirektion des Kantons gut zusammenarbeiten, um den Gesundheitsstandort Zürich zu stärken.
Das Thema «Deutsche an der Uni» sorgt immer wieder für Schlagzeilen, zuletzt bei der Besetzung eines Publizistik-Lehrstuhls. Verstehen Sie die Aufregung?
Das Thema beschäftigt die Bevölkerung. Daher müssen wir es erklären. Die Uni Zürich versteht sich als Forschungsuniversität, und wir wollen in bestimmten Gebieten Weltspitze sein. Wir brauchen also die besten Forscher in Zürich. Das heisst aber auch, dass die besten Kandidaten oft nicht Schweizer sind. Wir rekrutieren nicht nur Deutsche, wir haben auch viele Kanadier, Amerikaner, Franzosen, Italiener, Holländer, Engländer, Japaner, Inder . . .
Es hat Ihrer Meinung nach also nicht zu viele Deutsche?
Ich finde es beleidigend, dass man Leute, die sich für die Uni und die Studierenden einsetzen, nur wegen der Farbe des Passes verunglimpft. Da werde ich mich klar dagegen einsetzen: So nicht!
Viel zu reden gibt das Lehrstuhlsponsoring, insbesondere das Engagement der UBS, die mit bis zu 100 Millionen Franken fünf Lehrstühle am Institut für Volkswirtschaftslehre sponsern will. Eine Gruppe renommierter Forscher wehrt sich dagegen. Sie befürchten, dass die Forschung beeinflusst wird. Teilen Sie die Bedenken?
Grundsätzlich finde ich Sponsoring eine super Sache. Aber gewisse Grundregeln müssen unbedingt eingehalten werden.
Die da wären?
Erstens: Die Freiheit in Forschung und Lehre darf nicht angetastet werden. Zweitens: Das Sponsoring muss kompatibel sein mit den strategischen Zielen der Universität. Drittens: Die Reputation der Uni muss gestärkt werden.
Wie macht man das?
Man muss schauen, von wem das Geld kommt und wofür es eingesetzt wird.
Also Transparenz schaffen.
Das ist Punkt vier. Es braucht volle Transparenz.
Die Sponsoringverträge müssen einsehbar sein?
Ja, diese Verträge müssen so aufgesetzt sein, dass man sie offenlegen kann. Sobald man etwas nicht öffentlich zeigt, kommen Fragen auf. Damit erweisen wir uns einen Bärendienst.
Die Geheimhaltung beim UBS-Vertrag war demnach falsch?
Ich weiss nicht, ob ich damals weiser gehandelt hätte. Aber jetzt, wo wir das Feedback kennen, würde ich Verträge so aufsetzen, dass man sie einsehen kann.
Zum konkreten Fall: Glauben Sie wirklich, dass an dem Institut künftig bankenkritische Forschung noch möglich ist?
Da muss ich eine kleine Korrektur machen. Es gibt kein neues Institut. Alle fünf Lehrstühle werden in das bestehende Institut für Volkswirtschaftslehre integriert, sie unterscheiden sich kein Jota von den anderen Lehrstühlen. Die Uni besetzt diese Lehrstühle, sie geniessen alle volle Freiheit in Forschung und Lehre. Bankenkritische Forschung ist dabei durchaus möglich und wird meines Wissens auch bereits durchgeführt.
Werden Sie versuchen, mit anderen Firmen ähnliche Verträge abzuschliessen?
Ich würde sehr gerne mehr Firmen als Sponsoren gewinnen. Wir brauchen mehr Drittmittel, und zwar öffentliche wie auch private. Wir müssen unsere Finanzierung diversifizieren.
Heute beträgt der Anteil der Drittmittel am Unibudget etwa 18 Prozent. Wie viel soll es in Zukunft sein?
Wir wären stolz, wenn wir den Anteil auf 20 bis 25 Prozent erhöhen könnten. Meine langfristige Vision ist, dass wir über unsere eigene Stiftung, die UZH-Foundation, Kapital erhalten in Form von Schenkungen, über das wir selber verfügen können.
Sind die Maturanden heute gut auf das Studium vorbereitet?
Über das Niveau der Maturanden beklagen wir uns natürlich ständig. Die Mathekenntnisse seien schlecht, das Deutsch schlimm. Aber ich bin überzeugt, dass man sich schon vor 20 Jahren über die Maturanden beklagt hat. Jeder Generation geht es da gleich.
Ein ständiges Diskussionsthema ist die Maturitätsquote. Müsste man sie nicht erhöhen?
Ich fände es zum Beispiel gut, wenn wir mehr Physiker hätten, aber es ist nicht gesagt, dass es mit mehr Maturanden auch mehr Physiker geben würde. Zurzeit ist der Markt ziemlich ausgewogen. Fast jeder Absolvent der Uni findet eine Stelle, gleichzeitig suchen auch nicht massenhaft Jugendliche eine Lehrstelle.
Einspruch: Wir importieren viele Akademiker. Vor allem in der Medizin sind wir auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen.
Ich finde das auch nicht in Ordnung. Die Uni Zürich wird ab kommendem Herbst die Zahl der Studienplätze von 240 auf 300 erhöhen. Wir werden also 60 Mediziner mehr ausbilden.
Es bräuchte aber noch mehr.
Wir haben gemacht, was wir kurzfristig machen konnten. Das Medizinstudium ist praktisch angelegt, und mit der bestehenden Infrastruktur kommen wir einfach an Grenzen.
Was lief falsch?
Der Numerus clausus ist ein Rohrkrepierer. Man hatte Angst, wir würden zu viele Ärzte ausbilden, nun merken wird, dass es zu wenige sind.
Christian Amsler, der Präsident der Erziehungsdirektoren-Konferenz (EDK), fordert dafür einen Numerus clausus bei den Sozial- und Geisteswissenschaften. Wo es keine Jobs gebe, solle man nicht zu viele ausbilden. Wie sehen Sie das?
Ich bin dagegen. Die Studienabgänger finden Jobs, wir haben keine arbeitslosen Akademiker. Zudem sollen die Studierenden das studieren können, was sie wirklich begeistert.
Als Mittel gegen zu viele Studierende wird auch über eine Erhöhung der Studiengebühren diskutiert. Wie sehen Sie das?
Ich glaube nicht, dass eine finanzielle Barriere die richtige Selektionsmethode ist. Auf Bachelor- und Masterstufe finde ich es sehr wichtig, dass alle Schweizer Maturanden die Möglichkeit haben, an einer Uni zu studieren.
Sollte man die Studiengebühren sogar abschaffen?
Ich könnte mir ein System mit null Studiengebühren sehr gut vorstellen. In einzelnen deutschen Bundesländern funktioniert das auch. Allerdings würde ich am jetzigen System nicht schrauben. Jedes Mal, wenn man mit den Gebühren hoch- oder runtergehen will, wehren sich Teile der Bevölkerung massiv.
Sie sind stark engagiert auf verschiedenen Ebenen der Unipolitik und der Forschung. Sie haben aber auch sechs Kinder im Alter von 4 bis 18 Jahren. Wie schaffen Sie das, alles unter einen Hut zu bringen?
Gutes Zeitmanagement und vor allem viel Unterstützung von meiner Frau. Ich wohne sehr nahe bei der Uni und kann über Mittag nach Hause zum Essen. Ich kann auch zu Hause arbeiten. Ich habe einen fliessenden Übergang zwischen privatem Leben und Berufsleben. Es gibt Leute, die eine klare Grenze brauchen, ich brauche das nicht. Ich kann dafür auch während der Arbeitszeit einmal etwas Privates unternehmen.
Die Kinder haben also etwas von ihrem Papi?
Da müssten Sie die Kinder selber fragen. Aus meiner Sicht ja. Normalerweise bringe ich die Kinder in die Schule. Ich bin auch für die Hausaufgaben zuständig. Das heisst, ich bin abends meistens rechtzeitig zu Hause und unterstütze sie. Zudem gehört ein Tag am Wochenende nur der Familie.
Sie üben noch viele andere Tätigkeiten aus, etwa als Verwaltungsrat der Firma EvalueScience. Führen Sie diese Tätigkeiten als Rektor weiter?
Ich plane, alles aufzugeben ausser einer Handvoll Stiftungen, bei denen der Stiftungszweck kompatibel ist mit dem Job als Rektor.
Und das Labor?
Ja, auch das Labor gebe ich auf. Zwar gibt es ein paar Kollegen in den USA, die beides nebeneinander machten. Ich habe es persönlich anders erlebt. Als ich in Cold Spring Harbor Gruppenleiter war, war James Watson, der Mitentdecker der DNA-Struktur, Präsident dieser Forschungsinstitution. Am Tag, als er diese Leitung übernahm, hat er seine Forschungsgruppe an den Nagel gehängt und allen gesagt: «Von jetzt an ist deine Forschungsgruppe auch meine Forschungsgruppe.» Das hat mir Eindruck gemacht; ich möchte es genauso machen.
Wurmforscher, Forschungspolitiker, Familienmensch, Hobbygärtner
«Ich bin von Natur aus sehr neugierig», sagt Michael O. Hengartner, der designierte Rektor der Universität Zürich. Daher sei die Forschung für ihn so interessant gewesen. Doch seine Neugier geht darüber hinaus. Er könne sich auch sehr schnell begeistern für Projekte von Kollegen. Wie als Beweis lief er beim Fotoshooting auf dem Campus Irchel der UZH schnurstracks auf zwei Forscher zu, die gerade die WLAN-Verbindung eines neuen Messgerätes testeten, und liess sich erklären, was sie genau machten.
Obwohl er selber mit Leidenschaft und erfolgreich geforscht hat – mithilfe des Fadenwurms Caenorhabditis elegans (siehe Foto) ist er der Frage nachgegangen, warum Zellen gezielt Selbstmord begehen können –, zögerte Hengartner keine Sekunde, als er vor rund 20 Jahren eine eigene Forschungsgruppe übernehmen konnte. Das Plus an dem Job als Gruppenleiter sei, sagt er, dass man dabei mehr Forschung bewirken könne, als wenn man selber forsche. Die gleichen Argumente galten, als er vor vier Jahren Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät wurde.
Die wissenschaftliche Laufbahn wurde Hengartner quasi in die Wiege gelegt. Sein Vater war Mathematikprofessor an der Université Laval in Québec, wo er mit vier Geschwistern aufwuchs. Seine universitäre Ausbildung absolvierte der heute 47-Jährige in Kanada und in den USA. Er promovierte beim späteren Nobelpreisträger Robert Horvitz am renommierten MIT.
Der künftige Rektor ist mit der Biologin Denise Hengartner verheiratet und hat sechs Kinder im Alter von 4 bis 18 Jahren. Daneben pflegt Hengartner noch ein Hobby: einen Obst- und Beerengarten, an dem er «enorm viel Freude hat». «Darin wächst alles, was bei uns gedeiht: Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Jostabeeren, Stachelbeeren, Maibeeren, Blaubeeren, Trauben, Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Kirschen, Kiwis, Feigen, Mandeln, Indianerbananen, Gojibeeren, Chinabeeren und japanische Himbeeren. Ein Riesenplausch im Sommer!»
Erschienen in der Sonntagszeitung vom 30.6.2013