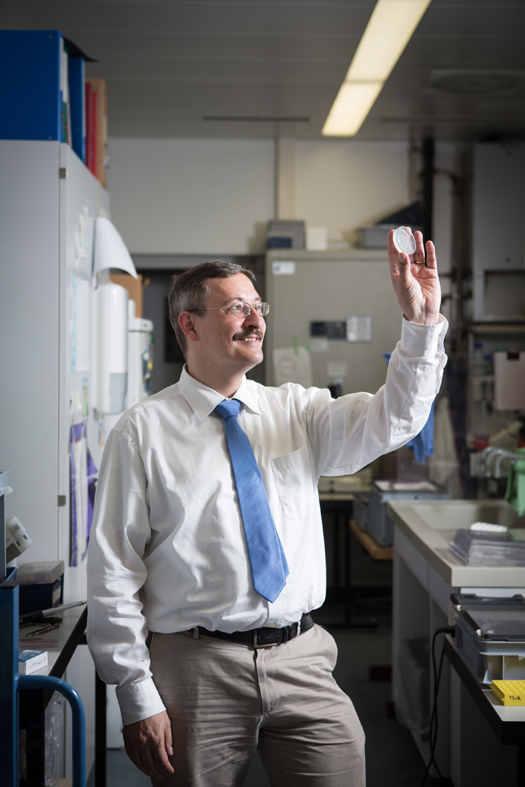Der Philosoph und Atheist Daniel Dennett über die Evolution des Glaubens und seine Art, Weihnachten zu feiern
Daniel Dennett
Interview: Nik Walter
Er ist einer der grossen Denker der Gegenwart, ein Brückenbauer zwischen Geistes- und Naturwissenschaften: der US-amerikanische Philosoph Daniel Dennett. Wir treffen ihn am Tag nach der «Zurich Minds»-Tagung in einem Nobelhotel in Zürich. Der 71-Jährige ist gut gelaunt, aus seinen Augen funkelt jugendlicher Schalk. Dennett gilt zusammen mit dem Evolutionsbiologen Richard Dawkins und dem Autor Sam Harris als intellektueller Wortführer des neuen Atheismus.
Daniel Dennett, Weihnachten steht vor der Tür. Werden Sie mit Ihrer Familie feiern?
Oh ja. Wir sind da sehr traditionell. Wir haben jedes Jahr ein Fest, bei dem alle im Anzug erscheinen, bei dem wir die besten Weihnachtslieder singen und ein grosses Bankett veranstalten. Wir nehmen das sehr ernst. Ich weiss allerdings nicht, ob überhaupt jemand dabei ist, der an Gott glaubt, aber wir alle lieben die Lieder, den Weihnachtsbaum und die ganze Zeremonie.
Sie sehen ein wenig aus wie die Personifizierung von Gott ...
… oder Nikolaus, oder Karl Marx. Oft werde ich auch gefragt, ob ich absichtlich wie Charles Darwin aussehen würde. Ich trage diesen Bart schon seit ich jung bin. Am Anfang sah ich aus wie Rasputin, recht beängstigend! Meine Kinder kennen mich nicht ohne Bart.
Als Philosoph und Atheist äussern Sie sich oft zu Fragen der Religion. Welche Rolle hat diese in unserer Gesellschaft?
Sie bietet eine wunderbare moralische Infrastruktur. Es geht um Teamwork und Gemeinschaft. Man muss zwar nicht religiös sein, um moralisch zu handeln. Aber für eine Gemeinschaft, die zusammenhält, braucht es eine Art Bindungsenergie. Und das machen Religionen ziemlich gut. Sie tun es allerdings oft, indem sie den Menschen etwas vortäuschen oder sie in die Irre führen. Das wollen wir unterbinden.
Eine gute Kirche bietet also vor allem Gemeinschaft.
Im Gedicht «The Death of the Hired Man» des grossen amerikanischen Dichters Robert Frost gibt es eine Zeile, die ich sehr mag: «Home is the place where, when you have to go there, they have to take you in.» Viele Menschen haben kein Zuhause.
. . . ausser der Kirche.
Die Kirche ist ein ausserordentlich gutes Ersatz-Zuhause für viele. Sie nimmt alle auf und bietet ihnen eine Gemeinschaft, die jeder Mensch braucht. Bis heute gibt es kaum weltliche Institutionen, die diese Aufgaben übernehmen könnten. Viele Aspekte der Religionen sollten wir daher bewahren, allerdings gemässigt.
Zum Beispiel?
Das Nicht-Wertende. Die Toleranz gegenüber allen Menschen, unbesehen ihrer Fähigkeiten, ist eine wunderbare Sache. Die Kirche sorgt so für Lebensunterhalt und Gemeinschaft, aber sie muss kontrolliert werden.
Toleranz gegenüber Anders- oder Nichtgläubigen wird aber in vielen Kirchen nicht grossgeschrieben.
Leider ja. Wenn sich das nicht ändert, sollen sie aussterben. Es gibt aber durchaus tolerante Kirchen, zum Beispiel einige protestantische Glaubensgemeinschaften.
Wie sieht es bei anderen Religionen aus, etwa beim Buddhismus?
Nun, ich hab da den Überblick nicht ganz. Jede grosse Religion hat mit dem Problem von Fanatismus und Intoleranz zu kämpfen, aber jede grosse Religion hat auch eine tolerante Seite. So habe ich zum Beispiel in der arabischen Welt oft eine wunderbare Gastfreundschaft und Toleranz erlebt, die man gerne übersieht.
Die Geschichte zeigt, dass die grossen Religionen immer wieder Kriege anzettelten und für viel Unheil sorgten. Gehört das zur Natur der Religionen?
Es gibt Forschungsarbeiten, die sehr pessimistische Folgerungen haben. Demnach ist Fremdenfeindlichkeit der Preis für Offenheit und Vertrauen innerhalb einer Gruppe. Wir gegen die anderen. Je enger die Gruppe zusammenhält, desto undurchlässiger ist die Membran, welche die Gruppe vom Rest der Welt abschottet.
Auch Schimpansengruppen schotten sich ab . . .
. . . und jede Zelle und jeder lebende Organismus. Eine Zelle muss sich gegen die Aussenwelt schützen. Diese Abgrenzung hat etwas sehr Fundamentales. Wir gegen die anderen, dieses Schema findet man überall.
Seit es die Menschheit gibt, gibt es auch Religionen. Sind sie ein Produkt der Evolution?
Als ich ein Buch über Religion und Evolution schrieb, wurde ich immer wieder gefragt: Wozu ist Religion gut? Ich antwortete jeweils: Alle menschlichen Gruppen leiden an Erkältungen. Wozu ist das gut? Das ist nur gut für den Erreger. Das sind Parasiten, die man kaum los wird.
Religionen als Parasiten?
Ich sehe Religionen als eine Sammlung von kulturell vererbten Eigenschaften, sogenannten Memen, die in der menschlichen Gesellschaft gedeihen. Ich sehe sie daher als Symbionten.
Sie kritisieren die Religionen gerne und oft. Konkret werfen Sie den Kirchen vor, sie würden ihre Lehre einer genauen Überprüfung entziehen.
Die Religionen entwickelten sich über Jahrtausende in einer erkenntnistheoretischen Finsternis, wo sie aufgrund der Ignoranz der meisten Menschen gedeihen konnten. Heute geht das nicht mehr. Wir leben in einem offenen Zeitalter, und die Vorstellung, dass die Religion von einer genauen Überprüfung ausgenommen sein sollte, kann man nicht mehr akzeptieren – wie man auch die NSA oder die Banken nicht von einer Überprüfung ausnehmen kann. Ich will den Schleier der Religionen lüften.
Ihnen wird oft vorgeworfen, Sie seien ein arroganter Apostel der Wissenschaft. Wie reagieren Sie auf solche Anwürfe?
Ich stelle dann meistens die Gegenfrage: Wenn ich über Ölkonzerne sprechen würde oder über Banken, würden Sie mich dann auch als arrogant und beleidigend bezeichnen? Nein, lautet darauf die Antwort.
Aber es gibt doch einen Unterschied zwischen Religionen und einer Ölfirma!
Ich würde sagen, sie sind gar nicht so verschieden. Beide sind mächtige Institutionen, beide sind nach den Absichten ihrer Leader und Mitglieder strukturiert. Meiner Meinung nach sollten zum Beispiel Versicherungskonzerne intensiv studiert werden, Kirchen aber genau so intensiv.
Werden die Religionen mittelfristig verschwinden?
Ja und nein. Die Dinge ändern sich sehr schnell, viel schneller als manche Leute denken. Ich sage manchmal: Die Dinosaurier sind nicht ausgestorben, sie leben heute in den Bäumen, denn Vögel stammen von den Dinosauriern ab. Ähnlich könnten sich die Kirchen weiterentwickeln, besser angepasst für das 21. Jahrhundert. Wenn sie offen und vernünftig sind und sich nicht hinter irgendwelchem Hokuspokus verstecken, dann sollen sie mehr Macht haben. Denn sie machen vieles gut.
Religionen muss man zugutehalten, dass sie viele Menschen glücklich machen.
Nun, Alkohol macht die Menschen auch glücklich. Und in Massen ist Alkohol auch etwas Gutes. Ich glaube, dass sich die Dinge rasch ändern. Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass viele Menschen sehr besorgt und verletzt sein werden, weil sich etwas, was sie sehr geschätzt haben, langsam in Luft auflöst. Traditionen, Kulturen, Gewohnheiten. Das wird sehr schmerzhaft.
Und Sie denken, dass das geschehen wird?
Das geschieht schon! Wir müssen standhaft und behutsam, geduldig und verständnisvoll sein. Wir müssen aber erkennen, dass die Gegenwart die Tradition erodiert und dass viele Menschen das nicht einfach so hinnehmen.
Man hat nicht das Gefühl, dass die Religionen aussterben.
Wenn man die ganze Welt anschaut, dann ist die am schnellsten wachsende Gruppe diejenige der Atheisten. Sie sind vielleicht weltweit schon in der Mehrheit.
Apropos Atheismus: Sie haben einen Essay geschrieben über fünf nicht gläubige Pastoren . . .
. . . letzte Woche publizierten wir dazu gerade ein Buch. Es heisst «Caught in the Pulpit – Leaving Belief Behind» (Gefangen auf der Kanzel – den Glauben hinter sich lassen). Darin veröffentlichen wir 30 weitere Interviews mit nicht gläubigen Pastoren.
Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, nicht gläubige Geistliche zu befragen?
Die ersten fünf zu finden, war wirklich schwierig. Nach der ersten Publikation sind viele andere auf uns zugekommen und wollten uns ihre Geschichte auch erzählen. Wir hatten mehr Anfragen, als wir bearbeiten konnten.
Wie weit verbreitet ist das Phänomen?
Das weiss niemand. Ich glaube, es handelt sich nur um die Spitze eines Eisbergs. Die Betroffenen wissen es auch nicht, weil sie es nicht mit ihren Kollegen besprechen können. Wir können Einzelfälle nicht generalisieren.
Gab es Coming-outs?
Oh ja. Nachdem unsere erste Studie publiziert wurde, entschied sich eine der Interviewten für ein Coming-out. Sie wurde über Nacht von ihrer Gemeinde ausgestossen, verdammt. In einem anderen Fall lief es viel besser.
Läuft das Projekt weiter?
Daraus ist eine neue Organisation entstanden, das Clergy Project. Das ist eine private, vertrauliche, Website für ehemalige oder noch amtierende Geistliche, die sich gegenseitig unterstützen wollen. Nur Geistliche können da mitmachen. Ich aber nicht, und Richard Dawkins, der das Ganze mitinitiiert hat, auch nicht. Das Projekt startete vor knapp zwei Jahren, ohne jegliche Publizität. Heute hat es über 500 Mitglieder, die meisten davon aktive Geistliche.
Und die sind alle nicht gläubig?
Oh ja, das ist eine Bedingung für die Aufnahme. Wir wissen demnach, dass es mindestens 500 nicht gläubige Geistliche gibt.
Philosoph, Darwinist, apokalyptischer Reiter
Der US-Philosoph Daniel Dennett gilt als Wortführer des Darwinismus und des Atheismus.
«Der Mensch ist ein natürliches Wesen, das im Prozess der Evolution aus der Tierwelt hervorgegangen ist.» Dies sei «Darwins gefährliche Idee» gewesen, schrieb Dennett 1995 im gleichnamigen Buch, denn sie zwinge den Menschen in ein naturalistisches Weltbild. Auch die Moral sei ein Produkt der Evolution. Ebenso der Geist. Dieser ist laut Dennett das, was das Hirn schafft. Er vertritt die «Philosophie des Geistes».
Der Religionskritiker Dennett, 71, bildete mit dem Evolutionsbiologen Richard Dawkins, dem Philosoph und Autor Sam Harris und dem verstorbenen Autor Christopher Hitchens die «vier apokalyptischen Reiter des neuen Atheismus». Heute würde Dennett, der an der Tufts University bei Boston lehrt, wohl eher Ingenieur werden. «Ich liebe es, herauszufinden, wie die Dinge funktionieren.»
Publiziert in der SonntagsZeitung vom 22.12.2013